Bitte verwenden Sie Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox.
Die Knochendichte und ihr Einfluss auf den Knochenschwund
Was ist die Knochendichte?
In der Physik beschreibt die Dichte das Verhältnis der Masse zum Volumen. Übertragen auf deine Knochen bedeutet Knochendichte also das Verhältnis zwischen der Knochenmasse zum Knochenvolumen, also dem Rauminhalt, den sie einnehmen. Im Englischen bezeichnet man sie auch als Bone Density Mass (BDM). Je höher der Wert ist, desto stärker und stabiler sind die Knochen. Ist die Knochendichte jedoch niedrig, dann sind die Knochen nicht sehr belastbar. Das Risiko für Knochenbrüche oder Frakturen steigt. Die Dichte der Knochen ist jedoch nicht festgelegt oder konstant. Sie verändert sich im Laufe des Lebens, da sie von verschiedenen Faktoren, unter anderem von Wachstums- und Sexualhormonen, beeinflusst wird. Zwischen dem 25. und 30. Lebensjahr ist sie am höchstens, wobei Männer im Durchschnitt einen 30 Prozent höheren Wert erzielen als Frauen. Danach nimmt die Knochendichte bei beiden Geschlechtern kontinuierlich ab.
Was bedeutet Knochenmasse?
Die Knochenmasse beschreibt das Verhältnis des Knochengewichts zum Körpergewicht. Im Durchschnitt beträgt die Knochenmasse bei Frauen etwa zwölf Prozent des Gesamtgewichts und bei Männern etwa 15 Prozent. Bei diesem Wert sind alle Bestandteile des Skeletts einberechnet, also
- Knochenstruktur
- Knochenhaut
- Knochenmark
- Nerven- und Blutbahnen
Wenn du eine Körperanalysewaage verwendest, um deine Knochenmasse zu messen, gibt diese dir jedoch lediglich die Knochenmineraldichte an. Bei gesunden Frauen mit einem Körpergewicht von 50 bis 75 Kilogramm sollte der Wert zwischen 2,2 und 2,6 Kilogramm liegen. Männer erzielen im Durchschnitt einen etwas höheren Wert. Bei einem Körpergewicht von 65 bis 95 Kilogramm sollte die gemessene Knochenmineraldichte etwa bei 3,0 bis 3,5 Kilogramm liegen. Mit zunehmendem Alter nimmt die Knochenmasse ab. Das hat Einfluss auf die Knochendichte.
Wie verändert sich die Knochenstruktur im Laufe des Lebens?
Deine Knochen befinden sich in einem stetigen Auf- und Abbauprozess. Etwa 20 bis 40 Prozent deiner Knochen werden jährlich neu gebildet und ersetzen alte Knochenstrukturen. Dabei werden einige schneller erneuert als andere. Im Durchschnitt kannst du davon ausgehen, dass sich dein Skelett etwa alle acht bis zehn Jahre vollständig umgewandelt hat. Für den Knochenaufbau sind die Osteoblasten verantwortlich. Ihre natürlichen Gegenspieler im Körper sind die Osteoklasten. Bis etwa zum 30. Lebensjahren halten sich diese beiden Arten von spezialisierten Knochenzellen die Waage. Mit zunehmendem Alter kommen Auf- und Abbau aus dem Gleichgewicht zum Nachteil der knochenaufbauenden Zellen.
Top Dienstleister in Zurich und Umgebung
-
Nürensdorf
Praxis Valeo
Bezahltes RankingBaltenswilerstrasse 2, 8309 Nürensdorf0 Bewetungen044 836 44 180448... Nummer anzeigen 044 836 44 18 *CHF/h 180.- -
Zürich
Enzler Béatrice
Bezahltes RankingTorgasse 6, 8001 Zürich0 Bewetungen043 268 47 770432... Nummer anzeigen 043 268 47 77 * -
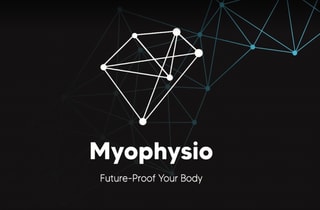 Buchs
BuchsMyophysio
Im Hag 11, 5033 BuchsMyophysio wurde mit 5 von 5 Sternen bewertet59 Bewetungen076 667 88 570766... Nummer anzeigen 076 667 88 57 *CHF/h 140.-
Was passiert bei Knochenschwund?
Knochen bestehen aus der Knochenwand und der Spongiosa. Die Spongiosa ist ein schwammartiges Gewebe und besteht aus feinen, verästelten Balken, den Trabakel. Zwischen den Trabakeln befinden sich kleine Hohlräume, in denen sich das Knochenmark befindet. Die Spongiosa ist nicht besonders fest, trägt jedoch wegen ihrer Bauweise dennoch zur Stabilität massgeblich bei. Knochenschwund oder auch Osteoporose beginnt häufig bei den Trabakeln. Ihre feine Struktur ist anfällig für minimale Frakturen. Diese können bereits bei kleinen Bewegungen oder Stössen auftreten, ohne dass du etwas davon bemerkst. Bei einem jungen und gesunden Menschen ist die Aktivität der Osteoblasten so hoch, dass diese kleinen Risse schnell repariert werden. Sinkt im Alter jedoch ihre Leistungsfähigkeit, kommen sie mit der Reparatur nicht mehr nach. Die kleinen Frakturen häufen sich und weiten sich auf immer grössere Bereiche aus. Der Knochen wird von innen porös und verliert an Stabilität und Knochendichte. Typische Symptome, die auf Knochenschwund hindeuten können, sind Schmerzen im Rücken und den Knien. Betroffene sind deutlich anfälliger für Knochenbrüche, diese können teilweise sogar ohne ersichtlichen Grund auftreten.
Welche Ursachen können dahinter stecken?
In den meisten Fällen entsteht Knochenschwund durch Störungen im Hormonhaushalt. Besonders die Sexualhormone Testosteron und Östrogen sind für die Regulation des Knochenstoffwechsels verantwortlich. Als weitere Ursachen können auch erbliche Faktoren in Frage kommen. Darüber hinaus ist Knochenschwund zum Teil auch ein natürlicher Alterungsprozess. Nicht zuletzt können auch Bewegungsmangel, falsche oder einseitige Ernährung sowie starker Alkohol- oder Nikotinkonsum für einen Knochenschwund verantwortlich sein und die Knochendichte negativ beeinflussen.
Warum sind Frauen besonders häufig betroffen?
Wie bereits erwähnt, sind Östrogen und Testosteron massgeblich an der Steuerung des Knochenstoffwechsels beteiligt. Bei Frauen sinkt der Östrogenspiegel ab dem Einsetzen der Wechseljahre. Das hat einen negativen Einfluss auf den Knochenaufbau und fördert Knochenschwund. Bei Männern sinkt der Testosteronspiegel jedoch kaum, daher sind sie seltener von Osteoporose betroffen als Frauen. Darüber hinaus ist, wie bereits erwähnt, die Knochenmasse und Knochendichte bei Männern im Allgemeinen höher.
Welche Vitamine und Nährstoffe können Knochendichte und Knochenstruktur verbessern?
Die folgenden Vitamine und Mineralstoffe tragen zur Stabilität deiner Knochen bei:
- Vitamin D
- Vitamin K
- Kalzium und Magnesium im Verhältnis zwei zu eins
- Silizium
Neben Vitaminen und Mineralstoffen solltest du ausserdem darauf achten, deinen Körper nicht zu übersäuern. Fertiggerichte und tierische Proteine können für ein saures Milieu im Körper sorgen. Dieser sollte durch basische Mineralstoffe wie Magnesium oder Kalzium neutralisiert werden. Wenn sie nicht in ausreichender Menge in der Nahrung vorhanden sind, löst der Körper die Mineralstoffe aus den Knochen.
Der Osteopathievergleich für die Schweiz. Finde die besten Osteopathen in deiner Nähe - mit Preisen und Bewertungen!
Top Ortschaften mit Osteopathen
Das könnte dich auch interessieren
Schambeinentzündung: Symptome, Ursachen und Behandlungsmethoden im Überblick
Eine Schambeinentzündung ist sehr schmerzhaft und tritt besonders häufig, aber nicht ausschliesslich, bei Sportlern auf. Die Erkrankung ist in der Regel harmlos und heilt mit den richtigen Behandlungsmassnahmen wieder vollständig aus. Wodurch eine Schambeinentzündung verursacht wird, welche Beschwerden für die Erkrankung typisch sind und vieles mehr kannst du hier nachlesen.
Spondylolyse erkennen und erfolgreich behandeln
Während eine Spondylose alle degenerativen Erkrankungen an der Wirbelsäule bezeichnet, ist die Spondylolyse eine Verschiebung der einzelnen Wirbelkörper. Sie tritt in den meisten Fällen im Bereich der Lendenwirbel auf. Hier kann sie Rückenschmerzen verursachen, die in die Beine und das Gesäss ausstrahlen. Bei zahlreichen Patienten aber verläuft die Erkrankung völlig ohne Symptome. Erster Ansprechpartner bei einer Spondylolyse ist der Orthopäde oder auch die Neurochirurgie, falls es zusätzlich zu neurologischen Ausfällen wie Lähmungserscheinungen kommt. Die Therapie wird entsprechend der zugrunde liegenden Ursache gewählt.
Sehnenscheidenentzündung am Handgelenk: Risikofaktoren, Symptome und Therapie
Eine Sehnenscheidenentzündung am Handgelenk tritt sehr häufig auf – nicht nur bei Sportlern, sondern auch bei Personen, die viel am Computer arbeiten. Nachfolgend kannst du nachlesen, welches die typischen Symptome für eine Sehnenscheidenentzündung am Handgelenk sind, wodurch sie konkret verursacht wird und wie die Therapie der Erkrankung aussieht. Auch dann, wenn du wissen möchtest, wie du Sehnenscheidenentzündungen am Handgelenk effektiv vorbeugen kannst, findest du hier wichtige Informationen.
Osteopenie: Der Vorstufe der Osteoporose vorbeugen
Die Osteoporose ist eine gefürchtete Erkrankung, bei der Patienten im Extremfall bis zu sechs Prozent ihrer Knochenmasse im Jahr verlieren. Die Folgen sind Rückenschmerzen und eine erhöhte Anfälligkeit für Knochenbrüche. Auch die Ausbildung eines Rundrückens ist charakteristisch für die Erkrankung. Es gibt aber bereits eine Vorstufe, die sogenannte Osteopenie. Solltest du entsprechende Symptome bei dir feststellen, suchst du am besten unverzüglich einen Arzt auf und lässt eine Knochendichtemessung durchführen. Zur Therapie kommen sowohl Medikamente als auch physikalische Therapien in Frage.
Sehnenentzündung an der Schulter richtig behandeln: Tipps und Tricks gegen die unangenehmen Schulterschmerzen
Schulterschmerzen gehören zu den besonders unangenehmen Beschwerden: Alltägliche Aufgaben fallen schwer, der Schmerz raubt dir den Schlaf und auch Sport ist zunächst tabu. Passende Hausmittel schaffen jedoch Abhilfe, wenn du zum Beispiel unter einer Sehnenentzündung an der Schulter leidest. Dabei gilt: Nicht immer handelt es sich um eine Sehnenentzündung, wenn sich auffällige Schulterschmerzen bemerkbar machen. Manchmal entpuppt sich der Schmerz als Begleitsymptom einer anderen Erkrankung. Deshalb ist ein Arztbesuch wichtig, um die Ursachen zu klären. Was es ausserdem zu beachten gibt, zeigt dir folgender Beitrag.
Chiropraktiker Krankenkasse: Wichtige Infos zu den gesetzlichen Leistungen
Wenn der Rücken schmerzt, immer wieder Kopfschmerzen auftreten oder der Nacken ständig verspannt ist, kann ein Chiropraktiker der richtige Ansprechpartner sein. Wer aber trägt die Kosten für die meist aufwändige Therapie? Versicherte in der Schweiz müssen sich keine Sorgen machen, da die Chirotherapie über die Grundversicherung abgedeckt ist. Welche Leistungen die Grundversicherung übernimmt und wo ihre Grenzen sind, erfährst du in unserem Ratgeber. Wir erklären dir zudem, wann du eine Überweisung deines Hausarztes für den Chiropraktiker brauchst und warum sich ein Krankenkassenwechsel lohnen kann.

