Bitte verwenden Sie Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox.
Die Liquorräume des Gehirns – Aufbau, Funktion und mögliche Krankheiten
Was sind die Liquorräume des Gehirns?
Als Liquorräume werden die Bereiche um das Zentralnervensystem bezeichnet, die den Liquor beziehungsweise das Gehirnwasser enthalten. Es existieren zwei Liquorräume, die durch eine der Hirnkammern miteinander verbunden sind. Das Hohlraumsystem mit der Flüssigkeit umgibt das Gehirn und das Rückenmark und bietet Schutz gegen Druckeinwirkungen, Erschütterungen und Überhitzung. Zudem verleiht der Liquor dem Gehirn Auftrieb und führt so zu einer Gewichtsminderung und Druckentlastung. Die Strukturen, die am Aufbau der Liquorräume beteiligt sind, können aber auch verändert sein und Krankheiten verursachen.
Wie ist der Aufbau der Liquorräume?
Die Liquorräume werden in den inneren und den äusseren Liquorraum unterteilt. Beide Räume sind über den vierten Ventrikel, der zwischen Hirnstamm und Kleinhirn liegt, miteinander verbunden. Der Aufbau des inneren Liquorraums umfasst die vier Ventrikel (Hirnkammern) sowie den Zentralkanal des Rückenmarks, während der äussere Liquorraum durch den Subarachnoidalraum gestellt wird. Der Subarachnoidalraum wird von den weichen Hirnhäuten begrenzt, der Arachnoidea und der Pia mater. Das Ventrikelsystem des inneren Liquorraums besteht aus den zwei Seitenventrikeln (Ventrikel eins und zwei) sowie dem dritten und vierten Ventrikel. Die Seitenventrikel sind untereinander und mit dem dritten Ventrikel verbunden. Die Verbindung zwischen dem dritten und vierten Ventrikel nennt sich Aquaeductus mesencephali. Über zwei seitliche Öffnungen und eine mittlere (Aperturae laterales und Apertura mediana) ist der vierte Ventrikel mit dem äusseren Liquorraum verbunden.
Was ist die Funktion der Liquorräume?
In den beiden Liquorräumen zirkuliert der Liquor beziehungsweise die Zerebrospinalflüssigkeit. Diese wird im inneren Liquorraum über den Plexus chorioideus (Geflecht aus Blutgefässen) aus dem Blutplasma gebildet. Sie umspült das Gehirn und das Rückenmark, bis sie im Subarachnoidalraum wieder resorbiert wird. Die Funktion des Hohlraumsystems ist also in erster Linie die Produktion des Gehirnwassers zum Schutz des Zentralnervensystems sowie die Wiederaufnahme der Flüssigkeit über die Arachnoidalzotten. Zudem ist der Liquor der Ursprung für die Innenohrflüssigkeit (Perilymphe). Inwieweit die Liquorräume und das Hirnwasser den Stoffwechsel der Nervenzellen unterstützen und zur Ernährung der Zellen und dem Abtransport von Metaboliten beitragen, bleibt zu erforschen.
Top Dienstleister in Zurich und Umgebung
-
Nürensdorf
Praxis Valeo
Bezahltes RankingBaltenswilerstrasse 2, 8309 Nürensdorf0 Bewetungen044 836 44 180448... Nummer anzeigen 044 836 44 18 *CHF/h 180.- -
Zürich
Enzler Béatrice
Bezahltes RankingTorgasse 6, 8001 Zürich0 Bewetungen043 268 47 770432... Nummer anzeigen 043 268 47 77 * -
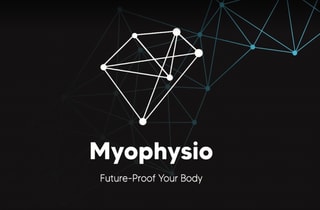 Buchs
BuchsMyophysio
Im Hag 11, 5033 BuchsMyophysio wurde mit 5 von 5 Sternen bewertet59 Bewetungen076 667 88 570766... Nummer anzeigen 076 667 88 57 *CHF/h 140.-
Was für eine Flüssigkeit enthalten die Hirnkammern?
Das Gehirnwasser ist eine klare, farblose Körperflüssigkeit. Sie enthält nur wenige Zellen und Eiweisse. Der Liquor wird kontinuierlich produziert und resorbiert. Etwa 150 bis 200 Milliliter der Flüssigkeit zirkulieren in den Liquorräumen und umspülen das Zentralnervensystem. Insgesamt produzieren die Liquorräume pro Tag zwischen 500 und 700 Milliliter, sodass der Liquor mehrmals pro Tag komplett erneuert wird. Der Arzt nutzt den Liquor für die Diagnose neurologischer Erkrankungen. Über die Liquorpunktion wird Liquor entnommen und im Anschluss analysiert. Bei Entzündungen des Gehirns oder der Meningen kann es zum Beispiel zu einer Erhöhung der Leukozyten (weissen Blutkörperchen) im Liquor kommen. Rote Blutzellen im Gehirnwasser deuten auf Blutungen hin.
Welche Krankheiten können an den Strukturen der Liquorräume auftreten?
Durch Veränderungen der Liquorräume oder der umgebenden Strukturen können diverse Krankheiten entstehen. Bei einem Hydrozephalus sind die Liquorräume direkt betroffen. Folgende Erkrankungen kommen vor:
- Erweiterung der Liquorräume (Hydrozephalus)
- Hirnödeme
- Entzündungen der Hirnhäute
- Hirnblutungen
- Tumoren
- Infektionen
Was ist ein Hydrozephalus?
Eine Erweiterung der Liquorräume mit Verdrängung der Hirnsubstanz wird als Hydrozephalus bezeichnet. Kommt es zu einer Erweiterung des Ventrikelsystems, spricht der Arzt von einem Hydrozephalus internus. Bei der Erweiterung des Subarachnoidalraums von einem Hydrozephalus externus. Ein Hydrozephalus kommt bei Kindern und Erwachsenen vor. Er entsteht durch eine erhöhte Liquorproduktion, einen gestörten Liquorabfluss oder eine verminderte Liquorresorption. Auch atrophische Prozesse (Geweberückbildungen) können zu Erweiterungen der Liquorräume führen. Das Auftreten von Tumoren im Bereich des Aquaeductus mesencephali ist zum Beispiel eine häufige Ursache für einen Hydrozephalus aufgrund einer Liquorabflussstörung. Seltener sind Verengungen durch Missbildungen wie beispielsweise die Chiari-Malformation.
Welche Symptome kommen bei erweiterten Liquorräumen vor?
Symptome, die auf einen Hydrozephalus hindeuten, können sich schnell oder langsam entwickeln. Dies hängt von dem Entstehungsmechanismus des Hydrozephalus sowie vom Alter des Patienten ab. Kinder weisen beispielsweise flexiblere Kopfstrukturen auf, die sich den Veränderungen anpassen, sodass sich typische Symptome oft später zeigen als bei Erwachsenen. Folgende Symptome können jedoch bei allen Hydrozephalus-Formen auftreten:
- Kopfschmerzen
- Schwindel
- Sehstörungen
- Übelkeit und Erbrechen
- Bewusstseinsstörungen
- Gedächtnisverlust
- motorische Auffälligkeiten
- Inkontinenz
Um eine Erweiterung der Liquorräume nachzuweisen, wird der Arzt die bildgebende Diagnostik nutzen. Die Computer- oder Magnetresonanztomografie sind Mittel der Wahl, um Schwere und Lokalisation festzustellen. Behandelbar ist ein Hydrozephalus durch die Ableitung von Hirnwasser über einen Shunt, der operativ in die betroffene Hirnkammer eingebracht wird.
Der Osteopathievergleich für die Schweiz. Finde die besten Osteopathen in deiner Nähe - mit Preisen und Bewertungen!
Top Ortschaften mit Osteopathen
Das könnte dich auch interessieren
Lumbalgie: Symptome, Ursachen und Behandlung der Kreuzschmerzen
Die Lumbalgie zählt zu den häufigsten Rückenerkrankungen überhaupt. Meist handelt es sich um chronische Schmerzzustände, die den Bereich des unteren Rückens betreffen. Menschen jeden Alters können von Schmerzen in der Lendenwirbelsäule betroffen sein, wobei die Ursachen vielfältig sind. Es kann sich dabei um chronische oder um akute Schmerzen handeln. Die akute Lumbalgie wird meist durch eine falsche Bewegung ausgelöst. Im Volksmund spricht man auch von einem Hexenschuss. Welche Therapie gewählt wird, hängt von der zugrunde liegenden Ursache ab.
Hüftschmerzen beim Liegen – Symptome, Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten
Im Schlaf kommt unser Körper normalerweise zur Ruhe und kann sich erholen. Aber nicht immer ist das möglich, zum Beispiel dann, wenn du nachts unter Schmerzen leidest. Nicht selten betroffen ist dabei die Hüfte, von der dann ein stechender oder ziehender Schmerz ausgeht. In unserem Ratgeber erfährst du, woher die Hüftschmerzen im Liegen kommen und was du dagegen tun kannst. Wir geben dir zudem wertvolle Tipps für effektive Übungen gegen die Beschwerden und zeigen dir die möglichen medizinischen Behandlungen und Therapien auf.
Medizinische Trainingstherapie – Wissenswertes über das Gesundheitstraining
Die Medizinische Trainingstherapie ist in der Praxis gewissermassen ein gesundheitsorientiertes Fitnesstraining. Sie hat Ähnlichkeiten und auch Überschneidungen mit der Physiotherapie sowohl in der Methodik als auch in der Zielsetzung. Dennoch geht sie weit darüber hinaus. Sie dient nicht nur der Rehabilitation und Regeneration nach diversen Erkrankungen oder Verletzungen, sondern nutzt die körperliche Leistungssteigerung als Behandlungsmethode. Ziel ist es letztlich, mittels einer Art Sportphysiotherapie den Bewegungsapparat zu stärken und damit belastbarer für den Alltag zu machen. Der Zweck dabei ist aber kein sportlicher – sondern die medizinische Vorbeugung sowie eine allgemeine Verbesserung der Lebensqualität.
Craniosacrale Behandlung: Sanfte Berührung für den perfekten Rhythmus
Eine alternative Behandlungsmethode, die die natürlichen Selbstheilungskräfte des Körpers aktiviert: Die craniosacrale Behandlung kann weitaus mehr als nur Entspannung vermitteln. Ihre Wirkung ist für Patienten in unterschiedlichsten Heilungsprozessen spürbar. Mit sanfter Berührung setzt die Methode auf Körperarbeit, um den natürlichen Rhythmus wiederherzustellen. Was genau verbirgt sich hinter diesem Ansatz, der aus der Osteopathie stammt? Wichtige Fragen zu Wirkung und Risiken, Techniken und Kosten beantworten wir in diesem Artikel.
Kniescheibe rausgesprungen? Ursachen und Therapien bei einer schmerzhaften Verrenkung des Kniegelenks
Wenn die Kniescheibe herausgesprungen ist, spricht der Facharzt von einer Patellaluxation. Die Verrenkung ist mit starken Schmerzen verbunden und kann bei falscher Behandlung weitere Verletzungen und gesundheitliche Beschwerden nach sich ziehen. Daher ist es umso wichtiger zu wissen, was in so einem Fall zutun ist und worauf du unbedingt achten solltest. Die häufigsten Ursachen, Therapiemöglichkeiten und viele hilfreiche Tipps bei einer Kniegelenksverrenkung haben wir dir nachfolgend zusammengestellt.
Die Coxa saltans oder schnappende Hüfte – Krankheitsverlauf, Symptome und Therapie
Knackende Geräusche in den Gelenken kennt jeder. Seltener ist eine fühl- und hörbar schnappende Hüfte. Die Erkrankung wird Coxa saltans genannt und – das die gute Nachricht – lässt sich gut behandeln. Eine mögliche Therapie sind etwa Faszienübungen und Krankengymnastik, um das Geräusch und eventuelle Schmerzen wieder zu reduzieren. Alles rund um das Thema „Coxa saltans“ haben wir dir hier zusammengestellt.

